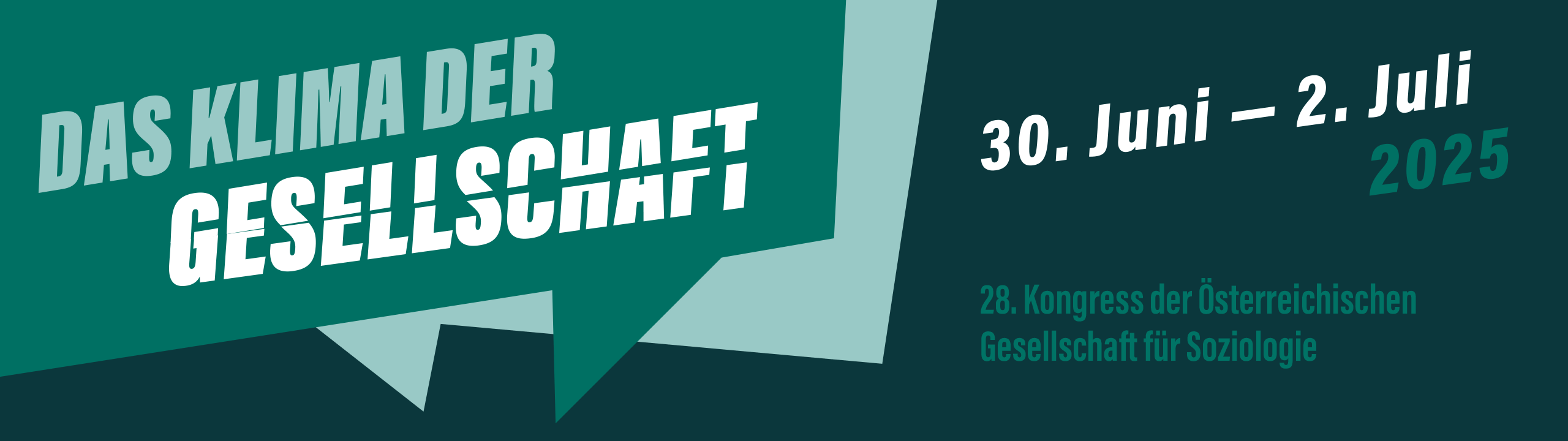Themenpapier
Download des Themenpapiers (pdf)
Dass es um das Klima der modernen Gesellschaft nicht zum Besten bestellt sei, vermutete schon die frühe Soziologie. Anstelle unvermittelter Beziehungen, so diagnostizierte sie, treten durch Vertrag und Tausch vermittelte Beziehungen. Nähe und Natürlichkeit werden der Herrschaft von Geld, Zweckdenken und rationalem Kalkül geopfert. Damit etabliert sich eine unüberwindliche Distanz zu den Menschen und Dingen. Die hochgradige Organisiertheit des modernen Lebens macht Affektkontrolle zum obersten Gebot, so Norbert Elias. An die Stelle echten Miteinanders tritt eine seelenlose Mechanik des bloßen Nebeneinanders. „Man geht in die Gesellschaft wie in die Fremde“, heißt es bei Ferdinand Tönnies. Die Kälte der Gesellschaft – das war das Problem der frühen Soziologie.
Ist diese Kälte auch noch unser gegenwärtiges Problem? Mit kritischem Blick auf prekäre Arbeitsverhältnisse, unzulängliche Integrationskonzepte, geschlechtsspezifisch verteilte Care-Lasten oder Altersarmut ist heute oft genug von „sozialer Kälte“ die Rede. Eine vom Neoliberalismus auf die Spitze getriebene „Hyper-Individualisierung“, so argumentiert ein Kreis um John W. Meyer, führe zu abnehmendem Gemeinsinn und generalisierter Institutionenskepsis. In der Folge wird der Wohlfahrtsstaat als Innovationshemmnis attackiert, die Demokratie als ineffizient, die Wissenschaft als autoritär. Der subjektive Eindruck wird zur „authentischen“ Wahrheit und damit zum besseren Wissen aufgewertet. Zugleich rückt das Gefühlsleben des vereinzelten Individuums wieder ins Zentrum des gesellschaftlichen Lebens, eine Entwicklung, die Eva Illouz als Aufstieg des „Homo Sentimentalis“ beschreibt. Der Siegeszug der Selbstbezüglichkeit, so könnte man sagen, spiegelt sich auf verschiedenen Ebenen: in der immensen Bedeutung der Selbstdarstellung durch soziale Medien, in der Selbstfindung durch Psychotherapie und der Selbstoptimierung durch Spiritualität und Sport. Dass die moderne Gesellschaft die sozialmoralischen Quellen gemeinschaftsstiftender Solidarität und Fürsorge trockenlegt, beklagte der Kommunitarismus schon in den 1990er Jahren.
Jedoch: Die Metapher der „Kälte“ ist für eine umfassende Beschreibung gegenwärtiger gesellschaftlicher Problem- und Konfliktlagen ganz sicher unzulänglich. In Begrifflichkeiten wie Polarisierung, Moralisierung oder Populismus werden aktuell Phänomene greifbar, die eher auf „Überhitzung“ schließen lassen. Die Pandemie hat dies in krisenhafter Verdichtung greifbar werden lassen: Scharfe, emotional und moralisch aufgeladene Grenzziehungen zwischen „Geimpften“ und „Ungeimpften“ haben Stereotype etabliert, Konflikte angefacht und Verständigung schwer gemacht. Die Unzufriedenheit mit der Krisenpolitik konnte durch „Polarisierungsunternehmer“ (Steffen Mau) erfolgreich bewirtschaftet und für populistische Zwecke nutzbar gemacht werden. Die kollektive Erregung wurde hochgehalten, Besonnenheit und Sachlichkeit gerieten in die Defensive. Die Wissenschaft wurde zur Zielscheibe von Ablehnung und Hass.
Es bedarf jedoch nicht nur krisenspezifischer Anlässe, um das Klima der Gesellschaft aufzuheizen. Auch gesellschaftliche Mega-Trends wie Digitalisierung, Finanzialisierung oder Beschleunigung tragen zur Überhitzung bei: Soziale Medien, die in der Regel das Aufgeregte und Aufregende besonders prämieren, fördern Empörungskommunikation. Künstliche Intelligenz sowie gezielte digitale Einflussnahme und Manipulation, so die Befürchtung, lassen die Demokratie erodieren, weil freie Wahlen unmerklich manipuliert werden und die Grenze zwischen wahr und falsch verschwimmt. In dem durch Aktienmärkte gesteuerten Finanzkapitalismus zwingt das Primat kurzfristiger Profitmaximierung zu beschleunigter Reaktionsbildung unter hochgradiger Unsicherheit. Biographische Unsicherheiten werden durch einen immer rascheren Wandel von gesellschaftlichen Erwartungen und Ansprüchen potenziert. Religiös-fundamentalistische Bewegungen bieten ideologisch überhitzte Resonanzräume zur Verarbeitung modernitätsspezifischer Verunsicherung und steigern die Rhetorik der Gewalt zu Heilszwecken. Es ist vielleicht kein Zufall, dass all diese Entwicklungen, die auf einen gesellschaftlichen Klimawandel hinweisen, in Zeiten der globalen Erderwärmung stattfinden – während vor 100 Jahren, als die Angst vor der kalten Gesellschaft aufkam, von den Geowissenschaften noch eine nächste Eiszeit prognostiziert wurde.
Die Frage nach dem Klima der Gesellschaft muss natürlich auch die dynamischen Prozesse in der Erdatmosphäre berücksichtigen, eben die „Klimafrage“. In der Rede von einer neuen geohistorischen Epoche, dem Anthropozän, bündelt sich der Eindruck vom beispiellosen Einfluss moderner Gesellschaften auf die Natur. Artensterben, Umweltverschmutzung, Landverbrauch oder die globale Erwärmung sind Beispiele für diesen Einfluss. Lange genug galt die Natur auch der Soziologie als bloßes Objekt und beliebig nutzbare Ressource. Doch das Klimaproblem zeigt, dass die Natur eine Wirkungsmacht hat, weil sie ganz offensichtlich Reaktionen auf das menschliche Einwirken zeigt. Es gibt jetzt „Kipppunkte“, „planetarische Grenzen“ und „kritische Zonen“. Bruno Latour hat deshalb vorgeschlagen, Natur neu zu verstehen, nicht als tote Materie, sondern als gesellschaftlich relevante Instanz mit Subjektstatus, als „Erde“ – eine Perspektive, die in außereuropäischen Ontologien postkolonialer Diskurse seit längerem präsent ist und in de- und postkolonialen Zugängen eine wesentliche Bedeutung hat.
Wie immer man zu diesen Vorschlägen steht, deutlich wird daran, dass jeder Kampf um ein besseres, lebensfreundliches Klima immer ein gesellschaftlicher Kampf um Deutungshoheit ist, gibt es doch nicht „die“ Klimakrise, sondern nur gesellschaftliche Diskurse, in deren Rahmen sich das Klimaproblem konstituiert. Das Klima oder die Natur können sich der Gesellschaft eben nicht direkt mitteilen, sondern nur über den Umweg wissenschaftlicher Beobachtung und öffentlicher Besorgnis. Der gesellschaftliche Diskurs entscheidet darüber, für welche Leiden wir empfänglich sind und was wir als gesellschaftliche Missstände begreifen. Das schließt natürlich die Möglichkeit ein, dass manche Krisen gar nicht als Krise wahrgenommen und behandelt werden können, weil dafür die Semantik fehlt. Dabei haben Naturkatastrophen das Potenzial, eine entsprechende Semantik auf den Weg zu bringen und damit den Diskurs zu prägen. Unzweifelhaft gilt auch, dass die unmittelbaren Gefährdungslagen und Risiken der Erderwärmung gesellschaftlich ungleich verteilt sind und zu einer Reihe von emotional aufgeladenen Klimaprotesten beigetragen haben. Die Klimaproteste skandalisieren die Verfestigung klimaschädlicher Praktiken durchaus öffentlichkeitswirksam, aber zum Teil unter Anwendung von Protestformen, die dem gesellschaftlichen Klima nicht immer förderlich sind. Dies macht erneut deutlich, wie eng das natürliche mit dem gesellschaftlichen Klima verflochten ist.
Auf diesem ÖGS-Kongress wird daher in vielfältiger Weise zur Diskussion gestellt, wie es gegenwärtig um das Klima der Gesellschaft bestellt ist und welchen Beitrag die Soziologie zur Bearbeitung der Klimakrise liefern kann. Zur Beantwortung dieser Frage ist die gesamte Soziologie gefordert, denn offenbar ist das Klima nicht nur ein umweltsoziologisches Thema. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Begriff des Klimas im wörtlichen und übertragenen Sinne zu nutzen, um gegenwärtige Transformationsprozesse, Widerstände und Konfliktlagen mit Blick auf deren tragende Diskurse, Institutionen und Praktiken zu analysieren.
In einer Reihe von Plenarveranstaltungen, Ad-hoc-Gruppen und Sektionsveranstaltungen soll auf diese Weise den Verflechtungen zwischen „natürlichem“ und „gesellschaftlichem“ Klima nachgegangen werden.